Medienrezeption im Zeitalter des digitalen Selbstportraits
Unmöglichkeit von Generation
Der Versuch eine Generation anhand ihrer Verwendung von Selfies zu charakterisieren scheint von Vornherein zum Scheitern verurteilt. Wie soll einerseits das abstrakte Konstrukt ‚Generation‘ überhaupt eine Gruppe von Menschen griffig beschreiben, womöglich auch noch über kulturelle und soziale Grenzen hinweg? Und welchen Sinn hat es dann weiters solch eine Differenzierung über eine in sehr spezifische mediale Kontexte eingebundene Form, wie dem Selfie, zu versuchen?
Wenn aus einer Betrachtung von Selfies irgendeine verallgemeinerte Aussage zur aktuellen Medienrezeption möglich sein soll, so kann sich so eine Analyse nicht sehr mit deren partikulärer Verwendung aufhalten. Vielmehr muss die mediale Form ‚Selfie‘ selbst Gegenstand der Analyse sein. Erst über eine funktionale Einbindung in den aktuellen medialen Diskurs ist dann ihr Einfluss auf diesen Diskurs abschätzbar.
Konnotationen einer Form
Wie lässt sich ein Selfie charakterisieren? Die einfachste Beschreibung wäre als Foto einer Person, dass von dieser Person selbst aufgenommen wurde; also der Zusammenfall von Fotograf*in und Sujet. An dieses denotative Verständnis schließen sich jedoch noch einige Konnotationen an.
Ein Selfie hat immer einen zeigenden Charakter. Es wird in der Regel nicht aufgenommen um still im digitalen Kämmerchen zu verschwinden, sondern um etwas zu präsentieren. Personen, welche ich getroffen habe, Orte die von mir besucht wurden, vielleicht auch ein neuer Haarschnitt oder neue Kleider. Ich möchte dies als die repräsentative Funktion des Selfies bezeichnen.
Weiters hat ein Selfie etwas Spontanes, fast schon Zufälliges. Selfies werden in der Regel nicht technisch vorbereitet; sie werden mit Handys oder einfachen Point-and-Click Kameras aufgenommen; ihnen haftet immer etwas Dilettantisches, Amateurhaftes an. Sobald ein Selfie ausgearbeitet, störungsfrei oder gar perfekt wirkt, wird es nicht mehr als Selfie ernstgenommen; es erfüllt nicht mehr seine authentische Funktion.
Zuletzt ist der Begriff des ‚Selfies‘ eng mit dem von ‚Social Media‘ verknüpft. Facebook, Twitter, Instagram & Co sind quasi Bestimmungsort und natürliches Habitat der Selfies. In ihnen erfüllt sich ihre repräsentative Funktion und als Form spiegeln sie auch das grundsätzliche Verlangen ihrer Trägermedien nach Authentizität wieder.
Diese einzelnen Bedeutungsebenen stehen, so glaube ich, in einem interessanten Spannungsverhältnis, das bei genauerer Betrachtung der einzelnen Ebenen deutlich wird.
Das repräsentative Ich
Wenn ich vorhin eine repräsentativen Funktion des Selfies postuliert habe, so drängen sich mir rasch zwei Fragen auf: Was wird repräsentiert? Und: Gegenüber wem wird es repräsentiert?
Ein Selfie ist kein Passfoto. Ziel ist es nicht die biometrischen Daten eines Menschen festzuhalten. Es geht also beim Selfie in der Regel nicht darum etwas körperlich Essentielles darzustellen. Vielmehr geht es beim Selfie um den Kontext. Wenn ich Selfies eines neuen Haarschnitts oder einer neuen Brille poste, geht es um die Veränderung, der Kontext bin ich also selbst; prägnanter gesagt es geht um meinen geschichtlichen Kontext. Wenn ich Bilder von Reisen, Sehenswürdigkeiten oder neuen Lokalitäten online stelle ist hingegen mein räumlicher Kontext relevant. Wenn ich mich bei bestimmten Aktivitäten – Trainieren, Fortgehen, Essen – knipse dann möchte ich meinen kulturellen Kontext präsentieren. Und wenn ich mich schließlich mit anderen Menschen – Freund*innen, Promis, neuen Bekanntschaften, Familie – ablichte, dann ist eben dieser soziale Kontext entscheidend.
Diese verschiedenen kontextuellen Bereiche können sich natürlich immer überschneiden. Ein Selfie vom Urlaub mit Freund*innen beim Segeln schließt zumindest einen räumlichen, kulturellen und sozialen Kontext ein. Wichtig ist eben, dass der Inhalt des Selfies nicht eigentlich ‚ich‘ bin, sondern eher mein Kontext, also eine Verortung des Ichs.
Gegenüber wem möchte ich jetzt diesen Kontext präsentieren? Es liegt natürlich nahe hier die anderen Rezipient*innen des jeweiligen sozialen Netzwerks als Zielgruppe auszumachen. Meine „Follower“ bei Twitter, meine „Friends“ bei Facebook oder meine „Circles“ bei Google+ sind ja diejenigen, welche meine geposteten Selfies dann schlussendlich lesen können.
Doch diese Adressierung vergisst auf eine Person, nämlich die des Posters selbst: auf mich. Schließlich bin nicht zuletzt ich ja auch immer Rezipient des Mediums in dem ich poste; ich nehme genauso all diese kontextuellen Informationen wahr; ich verorte mich selbst mit ihnen auf eine ganz gewisse und konkrete Weise.
Ein Selfie hält also mein sozio-kulturelles Ich fest und stellt dieses konstruierte Ich auch gleich wieder in den sozio-kulturellen Diskurs. So wird das Selfie zum Schnappschuss des postmodernen Ichs. Wenn Claude Lévi-Strauss jeden von uns als „Straßenkreuzung auf der sich Verschiedenes ereignet“[1] beschreibt, so wäre das Selfie dann das Foto der Verkehrskamera das uns ein Alibi verschafft. Ein Alibi das laut und weithin proklamiert: „Das bin ich! So bin ich!“
Authentizität als subjektives Objekt
Um genau diese Alibi-Funktion erfüllen zu können ist jetzt aber eben eine gewisse Authentizität nötig. Das Selfie muss echt, muss authentisch erscheinen. Die Verwendung schlechter Kameras, die Spontanität des Schnappschusses und die Flüchtigkeit des jeweiligen Kontextes unterstreichen eben gerade diese Authentizität.
Genau hierzu verhilft auch der Zusammenfall von Subjekt und Objekt im Selfie. Dadurch dass ich mich selbst festhalte schneide ich die Zwischenfigur des Fotografen aus diesem Prozess heraus. Hierdurch gewinnt dieser mediale Prozess eine Direktheit: ein Foto von mir über mich und durch mich (gepostet).
In dieser Weise erlangt das Selfie die Qualität einer unmittelbaren Erfahrung. Jedoch wird diese unmittelbare Erfahrung paradoxerweise im Selfie scheinbar mitteilbar. Das Selfie scheint unsere subjektiven Perspektive, unsere kontingenten Lebenseindrücke festschreibbar und kommunizierbar zu machen.
Diese Authentizität und Direktheit ist jedoch keine notwendige Eigenschaft des Selfies sondern eine Zuschreibung. Ein Selfie ist nicht an und für sich authentisch, ist eben nicht unmittelbare Erfahrung, sondern wir empfinden ein Selfie als authentisch, es wirkt auf uns unmittelbar.
Mit Michel Foucault könnte man beim Selfie von einer Heterotopie[2] sprechen; einer verwirklichten Utopie; einem photographischen Raum, der für uns gleichzeitig als real wahrnehmbares Objekt existiert, aber auch die Utopie des Ichs abbildet. Unser Ich als Utopie, das für uns nicht wahrnehmbar und damit von zumindest fragwürdiger Existenz ist. Im Selfie scheint diese Utopie jetzt aber greifbar zu werden, bekommt einen konkreten, in gewisser Weise realen Ort. Diese Verknüpfung zwischen Utopie und Tatsache, eben die Heterotopie des Selfies, funktioniert aber nur über die Authentizität. Wenn wir dem Selfie nicht seine utopische Haltung abnehmen, nicht glauben, dass es etwas Wirkliches darstellt, zerfällt das Selfie zum bloßen Fantasiebild.
Die Lumpen der sozialen Medien
Ich habe ja bereits von den sozialen Medien als dem Habitat der Selfies gesprochen. Tatsächlich jedoch ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Seiten sogar noch stärker. Wenn wir die bisher nachgezeichneten Funktionen des Selfies nochmal Revue passieren lassen – Authentische (Re-)Präsentation eines sozio-kulturellen Ichs im medialen Diskurs – so lässt sich diese Beschreibung doch auch eins zu eins auf die sozialen Netzwerke an sich umlegen. Tatsächlich meine ich, dass das Selfie nicht nur in den Social Media vorkommt, sondern dass es quasi formaler Ausdruck dieser Medien ist.
Das Selfie ist also nicht zufällig so stark in Twitter, Facebook & Co. eingebunden. Vielmehr kommt in dieser Form der eigentliche Sinn dieser Medien zu ihrer Geltung. Im Selfie spiegeln sich die sozialen Medien wieder. Es ist die Quintessenz, die Kurzform der Ich-Suche im Web 2.0. Wenn mein Facebook Profil die Summation meines digitalen Ichs ist, so ist das Selfie dessen Grundbaustein, der nach den gleichen Regeln funktioniert und damit die gleichen Funktionen erfüllen muss.
Wie Walter Benjamins Lumpensammler[3], verbringen wir unseren digitalen Alltag damit ständig Fragmente aufzuklauben. Fragmente von Erfahrungen, Erinnerungen, Gefühlen – Fragmente unseres Ichs. Das Selfie ist eine Möglichkeit diese fragmentarische Erfahrungswelt festzuhalten, sie für uns und andere sichtbar zu machen. Gleich dem Lumpensammler ist es dann diese fragmentarische Tätigkeit die unsere Identität eigentlich ausmacht. Wir sind die Lumpen, die wir sammeln, und die Selfies sind die Lumpen der sozialen Medien.
Generation Selfie?
Wenn wir jetzt also über diese Ausführungen zurückblicken, was bleibt von der ‚Generation Selfie‘ die wir am Anfang thematisch vorausgesetzt haben?
Jacques Lacan schrieb vom Spiegelstadium im Entwicklungsverlauf von Kleinkindern. Er arbeitete dieses Stadium als zentral für den Prozess der Ichwerdung des Menschen heraus, das Spiegelstadium hat Ichfunktion:
„Man kann das Spiegelstadium als eine Identifikation verstehen im vollen Sinne, den die Psychoanalyse diesem Terminus gibt: als eine beim Subjekt durch die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung.“[4]
Das Selfie könnte man jetzt genauso verstehen. Indem uns unser Ich bildlich wird, ja wir es im Fall des Selfies überhaupt erst bildlich erzeugen, gestalten wir dieses Ich aktiv, verwandeln uns selbst anhand unserer digitalen Spiegel-Ichs. Indem wir uns in gewisser Weise beschreiben, schreiben wir auch ein gewisses Selbstbild fest.
So scheint mir das Selfie kein neues, sondern im Gegenteil, ein recht grundsätzliches Bedürfnis zu stillen. Es bekräftigt unsere Subjektivität – nach innen, wie nach außen. Wir bekommen einen Haltepunkt für unser Ich, indem es uns selbst in Bezug setzt, unsere Subjektivität kontextualisiert. Im gleichen Zug projizieren wir dieses Ich aber auch nach außen, etablieren unsere Subjektivität im Kontext anderer Subjekte, zeigen, dass wir auch existieren, auch Ich sind.
In diesem Zusammenhang löst sich jetzt also auch die Frage nach einer Generation Selfie auf. Statt eine Gruppe von Menschen über eine mediale Form zu definieren, definiert das Selfie die einzelnen Menschen der Gruppe als Subjekte. Es funktioniert so analog zu vielen anderen kulturellen Techniken. Verändert hat sich letztlich nur der Ort dieser Subjektivierung; sie passiert nunmehr vor dem Hintergrund internationaler und virtueller Netzwerke.
Auch die Identität des Selfies selbst liegt somit, so scheint es, nicht in sich selbst sondern lediglich in seinem Kontext.
Endnoten
[1] Lévi-Strauss: Mythos und Bedeutung, S. 15.
[2] Vgl. Foucault: „Andere Räume“.
[3] Vgl. Benjamin: „Ein Außenseiter macht sich bemerkbar“.
[4] Lacan, Jacques: „Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion“, S.64.
Quellenverzeichnis
Benjamin, Walter: „Ein Außenseiter macht sich bemerkbar. Zu S. Kracauer, Die Angestellten“. In: Benjamin, Walter / Tiedemann, Rolf (Hg.) / Schleppenhäuse, Werner (Hg.): Gesammelte Schriften 3. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, S.219-225. (Orig.: 1930).
Foucault, Michel: „Andere Räume“, In: Barck, Karlheinz (Hg.) / Gente, Peter (Hg.) / Paris, Heidi (Hg.in) / Richter, Stefan (Hg.): Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig: Reclam 1992, S. 34 – 46. (Orig.: 1967).
Lacan, Jacques: „Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion“. In: Lacan, Jacques / Haas, Norbert: Schriften 1. Berlin: Quadriga 1991, S. 61-70. (Orig.: 1949)
Lévi-Strauss, Claude: Mythos und Bedeutung. Vorträge. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1980.
Titelbild  Bernhard Frena. Adaptiert von https://openclipart.org/detail/91651/Al%20sleeping.
Bernhard Frena. Adaptiert von https://openclipart.org/detail/91651/Al%20sleeping.




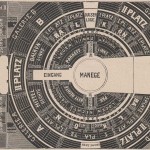

Kommentare von Bernhard Frena